 Die Größe eines Werks zeigt sich in der Vielfalt seiner Interpretationsmöglichkeiten. Wobei – im besten Falle – jedes einzelne „reworking“, eine von der Traditionslinie abweichende neue Sicht auf ein Werk, immer andere Facetten ursprünglicher Problemstellungen zutage fördern kann. Dies zeigt sich besonders bei „Giselle“, das wieder am Spielplan des Wiener Staatsballetts steht. Dass dieses romantische Ballett ebenso wie viele seiner neuen Fassungen oft mit Farben in Zusammenhang gebracht wird, kommt nicht von ungefähr.
Die Größe eines Werks zeigt sich in der Vielfalt seiner Interpretationsmöglichkeiten. Wobei – im besten Falle – jedes einzelne „reworking“, eine von der Traditionslinie abweichende neue Sicht auf ein Werk, immer andere Facetten ursprünglicher Problemstellungen zutage fördern kann. Dies zeigt sich besonders bei „Giselle“, das wieder am Spielplan des Wiener Staatsballetts steht. Dass dieses romantische Ballett ebenso wie viele seiner neuen Fassungen oft mit Farben in Zusammenhang gebracht wird, kommt nicht von ungefähr.
 Gerade in den letzten Jahren haben sich – vom Publikum enthusiastisch aufgenommene – neue Fassungen der 1841 in Paris uraufgeführten „Giselle“ etabliert, bei denen Farben nicht nur eine besondere Rolle spielen, sondern sogar – ebenso wie im Original, nur in anderer Weise – stücktragend sind. Man variiert dabei das Vorgegebene: ein meisterhaft konstruiertes Gegeneinander von Tanzstilen, das sich aus den verschiedenen Tanzräumen ergibt. Die farblich sinnliche Welt des Charaktertanzes, die in einer lieblichen Weingegend verankert ist, wird gegen eine weiße Klassik gestellt, die sich in einer von bläulichem Mondschein beleuchteten romantischen Waldlichtung entfaltet.Mit anderer Farbsymbolik zielten einige kürzlich entstandene Neuinterpretationen von „Giselle“ auf ganz Unterschiedliches ab: auf einen neuen Umraum der Handlung, auf die Kostüme allein, auf den anderswo verorteten Erzählstrang oder auf die Hautfarbe der Ausführenden. Mats Eks „Giselle“ aus dem Jahr 1982 etwa, die bei TANZ ’84 im Theater an der Wien zu sehen war, stand am Anfang des Farbenreigens, wobei bei dem schwedischen Choreografen die überlieferte Farbdramaturgie anders gewendete und stark intensivierte Nuancen erhielt. 1993 folgte Elena Tschernischova an der Wiener Staatsoper. Sie behielt in ihrer Einstudierung zwar das Tradierte bei, versuchte aber, der ursprünglichen Narration durch eine andere Farbgebung der Kostüme neue Aspekte abzugewinnen.
Gerade in den letzten Jahren haben sich – vom Publikum enthusiastisch aufgenommene – neue Fassungen der 1841 in Paris uraufgeführten „Giselle“ etabliert, bei denen Farben nicht nur eine besondere Rolle spielen, sondern sogar – ebenso wie im Original, nur in anderer Weise – stücktragend sind. Man variiert dabei das Vorgegebene: ein meisterhaft konstruiertes Gegeneinander von Tanzstilen, das sich aus den verschiedenen Tanzräumen ergibt. Die farblich sinnliche Welt des Charaktertanzes, die in einer lieblichen Weingegend verankert ist, wird gegen eine weiße Klassik gestellt, die sich in einer von bläulichem Mondschein beleuchteten romantischen Waldlichtung entfaltet.Mit anderer Farbsymbolik zielten einige kürzlich entstandene Neuinterpretationen von „Giselle“ auf ganz Unterschiedliches ab: auf einen neuen Umraum der Handlung, auf die Kostüme allein, auf den anderswo verorteten Erzählstrang oder auf die Hautfarbe der Ausführenden. Mats Eks „Giselle“ aus dem Jahr 1982 etwa, die bei TANZ ’84 im Theater an der Wien zu sehen war, stand am Anfang des Farbenreigens, wobei bei dem schwedischen Choreografen die überlieferte Farbdramaturgie anders gewendete und stark intensivierte Nuancen erhielt. 1993 folgte Elena Tschernischova an der Wiener Staatsoper. Sie behielt in ihrer Einstudierung zwar das Tradierte bei, versuchte aber, der ursprünglichen Narration durch eine andere Farbgebung der Kostüme neue Aspekte abzugewinnen.
Ganz anders Boris Eifman in seiner „Giselle Rouge“. In dem 1993 in St. Petersburg uraufgeführten und seit 2015 vom Wiener Staatsballett getanzten Werk leitet der Choreograf die Farbe Rot von jenem politischen Umraum der jungen Sowjetunion ab, in der seine Giselle – es handelt sich dabei um Olga Spessiwzewa, eine legendenumwobene Interpretin der Titelrolle – agiert. Im Rahmen von ImPulsTanz 2017 schließlich war mit Dada Masilos eben erst uraufgeführter Version eine, wie man sie bezeichnen könnte, „Giselle Noire“ zu sehen, in deren Zentrum „African Contemporary Dance“ steht. Was aber motiviert heute Lebende, sich mit einem vor mehr als 175 Jahren entstandenen Werk auseinanderzusetzen?
 Nuancen von Weiß
Nuancen von Weiß
Denkt man an die in „Giselle“ aufgegriffenen Themenkreise, so ist die wiederholte Hinwendung zu dem Werk keineswegs verwunderlich. Es ist nämlich zuallererst der Tanz selbst – die zur Tanzsucht gewordene Tanzleidenschaft der Protagonistin; die „Tanzmorde“, das Tanzen „ohne Ruh’ und Rast“ als Todesstrafe für die männlichen Hauptfiguren –, der 1841 in die damals aktuellen Ausprägungen des Bühnentanzes, seine Dramaturgie, seine Formen und Techniken gestellt wurde. (Dies – die Thematisierung der eigenen Mittel – geschah sehr bewusst, in selbstreflexiver Absicht und in Analogie zu der in ebendieser Zeit gepflegten Belcanto-Oper.) Des Weiteren werden thematisiert: Standesunterschiede, bewusste Täuschung, die zu geistiger Verrückung führt, das Aufeinanderprallen zweier Welten, das Versinken in fremden Daseinsräumen, eine über den Tod hinaus bestehende Liebe. Die stücktragenden und dem Ballett „Giselle ou Les Wilis“ titelgebenden „Willis“ aber stammen aus Heinrich Heines 1835 veröffentlichter Schrift „De l’Allemagne“. Auf Deutsch 1837 in „Elementargeister“ abgehandelt, berichtet der Dichter von der aus einem „Teile Östreichs“ stammenden Sage von gespenstischen Tänzerinnen – Bräute, die vor ihrer Hochzeit gestorben sind. Dass dieses Motiv dann in dem Ballett überzeugend verarbeitet wurde, wird durch Heine selbst belegt, der 1842 über die Giselle-Darstellerin Carlotta Grisi schreibt: „Ja, sie hat ganz den Charakter jener Elementargeister, die wir uns immer tanzend denken, und von deren gewaltigen Tanzweisen das Volk so viel Wunderliches fabelt.“
Nicht überraschend siedelt Ek in seiner Version die „Giselle“-Geschichte in der Gegenwart an, eine Änderung, die kaum eine Verschiebung der Charakterzeichnung der Agierenden nach sich zieht, denn Suchtverhalten äußert sich über die Zeiten auf ähnliche Weise. Auch bei Ek unterscheidet sich Giselle an sich schon von den anderen. 1841 vor allem „fragile“, ist Eks Protagonistin neurotisch, hypersensibel – wahrscheinlich rauschgiftsüchtig – und deswegen Außenseiterin. Anders die Tanzmotivation. Ist er ursprünglich freudig empfundener Zwang, so wird er bei Ek Zeichen „menschlicher Unterdrückung“, der in dem Maß verkrampfte Züge annimmt, als Giselle sich immer weniger imstande fühlt, Albrechts Spiel zu verkraften. Sie wird in eine von einer Oberschwester beherrschten Irrenanstalt eingeliefert, wo sie aber erneut Außenseiterin ist. Auch der zweite wesentliche dramaturgische Baustein des Balletts wird beibehalten: der Kontrast zwischen dem ersten und zweiten Akt. „Was mich besonders gefangen nahm“, so Ek über das Ballett von 1841, „sind die großen und starken Gegensätze in ‚Giselle‘. Einerseits der Realismus des ersten Akts auf dem Lande in einem Dorf und andererseits die traumhafte Romantik des zweiten Akts im nächtlichen Wald zwischen den drohenden gespensterhaften Wesen.“ In seiner Deutung behält Ek den originalen Farbkontrast zwar bei, sieht das Weiß des zweiten Akts aber völlig neu: Ek verändert das bläuliche Weiß des Mondes zum verstörenden Weiß einer klinischen Anstalt. Dazu kommen auch andere „Giselle“-Motive: so der Kontrast zwischen Individuum und Gruppe sowie der Standesunterschied zwischen den Personen, der ja im Originallibretto die Katastrophe auslöst. Giselle wird dabei, so Ek, „Brennpunkt von hoch und niedrig, Leben und Tod bilden hier eine Vereinigung, bei der sie in Stücke gerissen wird, aber wo ein Mensch entsteht“.
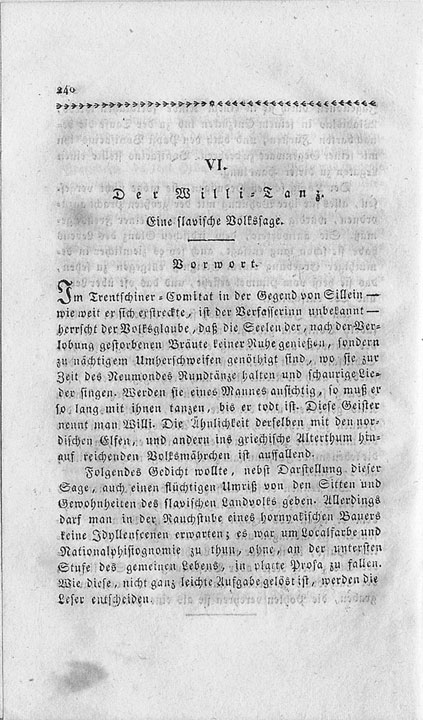 Eine Dichterin aus „Oberungarn“, dazu zwei Franzosen in Wien
Eine Dichterin aus „Oberungarn“, dazu zwei Franzosen in Wien
Die Tatsache, dass sich die „Giselle“ von 1841 in jeder nur möglichen Hinsicht wie aus einem Guss präsentiert, verleitet dazu, zu übersehen, dass das Werk Resultat einer echten Teamarbeit war. Doch hier soll nicht von den – freilich wichtigen – Librettisten Théophile Gautier und Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, nicht vom Komponisten Adolphe Adam, auch nicht von Heine die Rede sein, sondern vielmehr ausdrücklich jene Dichterin erwähnt werden, von der Heine das Motiv der Willis-Sage übernommen hat. Die in „Oberungarn“ (Slowakei) geborene Therese von Artner (1772–1829) nämlich war es gewesen, die den Sagenkreis um die Willis, den vor ihrer Hochzeit gestorbenen Bräuten, in dem Gedicht „Der Willi-Tanz. Eine slavische Volkssage“ literarisch festgehalten und 1822 in dem in Wien erschienenen „Taschenbuch für die vaterländische Geschichte“ veröffentlicht hatte. Damit ist Artner mitverantwortlich, dass „Giselle“ heute nicht nur weltweit gespielt wird, sondern auch für Tänzer wie für Choreografen Herausforderung geblieben ist. Von der Literaturwissenschaft wird Artner, von deren Bühnenwerken das Schauspiel „Stille Größe“ 1821 am Burgtheater zur Aufführung gelangte, auch als eine Autorin gesehen, die Anregungen an andere weitergegeben hat. Gemeint sind – neben Heine – Franz Grillparzer und Ferdinand Raimund. (Das Libretto zu Giacomo Puccinis 1884 uraufgeführter Oper „Le Villi” übrigens basiert nicht auf dem des Balletts „Giselle“, sondern auf Alphonse Karrs Erzählung „Les Willis“ aus dem Jahr 1835, die von Ferdinando Fontana zum Opernlibretto geformt wurde.)
Das „Giselle“-Libretto, das via Heine also letztlich auf Artner zurückgeht, 1841 in choreografische Form gebracht zu haben war das Verdienst zweier Franzosen, die beide mit Wien aufs Engste verbunden waren: Jean Coralli (1779–1854) – auch er ein Mitarbeiter am Libretto – und Jules Perrot (1810–1892). Beide Herren haben hier nicht nur ihr Handwerk geübt, sondern haben das in Wien Erprobte in vollendeter Form in Paris auf die Bühne gebracht. Beide ahnten wohl kaum, dass man sich, nach mehr als 175 Jahren, noch immer mühen würde, ihr Werk zu tanzen. Zudem war nicht vorauszusehen, dass zu der Farbdramaturgie ihrer „Giselle“ durch zeitgenössische Fassungen weitere „Leit“-Farben hinzukommen sollten: Abstufungen von Weiß und Schwarz, Nuancen von Weiß, „rouge“ oder auch „noir“.
Der in Paris geborene Coralli war erstmals 1805 als Tänzer und Choreograf nach Wien gekommen. Er hatte nur kurz (bis 1808) hier gearbeitet und war dann 1830 zurückgekehrt. Dass er da – wahrscheinlich als Erster – den Titel „Ballettdirektor“ trug, sei nur nebenbei erwähnt. Schon seit 1800 waren in Wien im Hinblick auf die Kunstgattung Ballett wesentliche Veränderungen in Gang geraten, die um 1830 fast abgeschlossen schienen. Geändert hatte sich das Autorenverständnis eines Balletts und damit auch die herangezogenen Sujets, die nun, von einem Librettisten verfasst, aus dem Themenrepertoire der Literatur, des Sprechtheaters und der Oper zum Ballett herübergezogen wurden. Zauberwelten, Bereiche und Wesen zwischen Leben und Tod, dazu das Motiv der Fremde als Ort der Zerstreuung, aber auch der Flucht, waren jene Themenbereiche, die sich, wie sich bald herausstellen sollte, von der neuen Balletttechnik – insbesondere dem Spitzentanz – weit überzeugender auf die Bühne stellen ließen, als dies Sprache oder Gesang vermochten. Geändert hatte sich auch die Werkanlage, wobei das scharf kontrastierende Gegenüber von der „Couleur“ des Landlebens mit seinem Tanzgenre und dem Weiß der in klassischer Tanztechnik erscheinenden Geister der Luft, des Waldes und der Wasser ein wichtiges Bauelement wurde. Damit Hand in Hand ging eine neue hohe Einschätzung von Tanz an sich, wobei man danach trachtete, eine ausgewogene Balance zwischen mimischer handlungsvermittelnder Aktion und Tanz herzustellen. Die Ingredienzien für das später so genannte „Romantische Ballett“ standen bereit. Dazu hatten sich in Wien, in Berlin, Paris und London sowohl ein neues Publikum als auch eine kundige Kritik etabliert. Als gleichwertige theatralische Äußerung gesehen, wurde Tanz in der Stadt an die Seite des schönen Gesangs und der großen Tragödie gestellt, in der Vorstadt neben die Possen, Zauberspiele und den scharfzüngigen Sprachwitz. Wobei man künstlerische Fertigkeit ebenso zu schätzen wusste wie herausragende Persönlichkeiten.
Ein Ballett, das Coralli in seiner zweiten Wiener Zeit herausbrachte, war Jean Aumers „Die Nachtwandlerin“, das von größter Bedeutung für die weitere Entwicklung des Bühnentanzes wurde. Mit der Nachtwandlerin nämlich steigt eines der weißen Wesen aus den unterbewussten Tiefen der Biedermeierwelt, mit denen sich die Ballettbühne nunmehr rasch bevölkerte. Das Ballett war umso bemerkenswerter, als es den Nukleus von Filippo Taglionis „La Sylphide“ (1832) enthält. Wien bekam später sehr schnell Corallis Pariser Meisterwerke zu sehen: 1839 das brillante Ballett „Der hinkende Teufel“ (1836), das in Zusammenarbeit mit der famosen Fanny Elßler entstanden war; 1842, zehn Monate nach der Uraufführung, „Giselle“.
 Perrot, der zweite Franzose in Wien, der im Zusammenhang mit „Giselle“ von Bedeutung ist, war 1836 als Tänzerstar nach Wien engagiert worden. Sein neuer fließend weicher Tanzstil war in aller Munde. Bewundert wurden die Leichtigkeit seiner Tanzweise, sein Können – und dies war wohl in dieser Zeit noch neu –, koordiniert zu springen, zu drehen, seine Fähigkeit, Balance zu halten, dazu, vermeintlich zu schweben. Sein Virtuosentum, präsentierte er zunächst zusammen mit Grisi – der Tänzerin, für die „Giselle“ entstand – in eingelegten Pas de deux, dann aber, nachdem ihn der Direktor des Hauses, Carlo Balocchino, aufgefordert hatte, doch selbst Ballette herauszubringen, in eigenen Kreationen. (Mit seinem Partner Bartolomeo Merelli lenkte Balocchino nicht nur die Geschicke des Kärntnertortheaters, sondern auch die der Mailänder Scala.) Zwei der Wiener Perrot-Ballette seien aufgrund ihres „Nachlebens“ festgehalten: „Die neapolitanischen Fischer“ (1838) könnte in August Bournonvilles „Napoli oder Der Fischer und seine Braut“ (1842) ein Echo haben, mit dem Feenballett „Der Kobold“ (1838) gelang Perrot ein richtiger Wurf, der in Wien auch insofern würdigen Widerhall fand, als Johann Nestroy das Werk mit seiner Zauberposse „Der Kobold oder Staberl im Feendienst“ parodierte.
Perrot, der zweite Franzose in Wien, der im Zusammenhang mit „Giselle“ von Bedeutung ist, war 1836 als Tänzerstar nach Wien engagiert worden. Sein neuer fließend weicher Tanzstil war in aller Munde. Bewundert wurden die Leichtigkeit seiner Tanzweise, sein Können – und dies war wohl in dieser Zeit noch neu –, koordiniert zu springen, zu drehen, seine Fähigkeit, Balance zu halten, dazu, vermeintlich zu schweben. Sein Virtuosentum, präsentierte er zunächst zusammen mit Grisi – der Tänzerin, für die „Giselle“ entstand – in eingelegten Pas de deux, dann aber, nachdem ihn der Direktor des Hauses, Carlo Balocchino, aufgefordert hatte, doch selbst Ballette herauszubringen, in eigenen Kreationen. (Mit seinem Partner Bartolomeo Merelli lenkte Balocchino nicht nur die Geschicke des Kärntnertortheaters, sondern auch die der Mailänder Scala.) Zwei der Wiener Perrot-Ballette seien aufgrund ihres „Nachlebens“ festgehalten: „Die neapolitanischen Fischer“ (1838) könnte in August Bournonvilles „Napoli oder Der Fischer und seine Braut“ (1842) ein Echo haben, mit dem Feenballett „Der Kobold“ (1838) gelang Perrot ein richtiger Wurf, der in Wien auch insofern würdigen Widerhall fand, als Johann Nestroy das Werk mit seiner Zauberposse „Der Kobold oder Staberl im Feendienst“ parodierte.
„Clair-obscur“, „Rouge“ und „Noir“
 „Giselle in Schwarz-Weiß – warum nicht?“ Mit dieser durchaus als Provokation gestellten Frage übertitelt Tschernischova den Kommentar zu ihrer Produktion, die sie an der Wiener Staatsoper herausbrachte. Das Sujet von „Giselle“ sei, so Tschernischova, ein Glücksfall für das Theater, es behandle Themen wie „Liebe, Treue, Tod, Verrat“. Hier stehe das volle Leben vis à vis einer geheimnisvollen überirdischen Welt. Um den Kontrast dieser beiden Welten deutlicher herauszuarbeiten, verzichtet Tschernischova auf das tradierte Gegenüber von Farbigkeit und Weiß und betont stattdessen das „Clair-obscur“, das Helldunkel, das ihrer Meinung nach durch das Licht zusätzliche Tiefe und Schattierung gewinnt. „Durch den schwarz-weißen Hintergrund“, so die Ballettmeisterin, „wird alles, was auf der Bühne vor sich geht, nur noch verstärkt.“ Damit wolle sie dem Werk jene „etwas schärferen Konturen verleihen“, die für heute nötig seien.
„Giselle in Schwarz-Weiß – warum nicht?“ Mit dieser durchaus als Provokation gestellten Frage übertitelt Tschernischova den Kommentar zu ihrer Produktion, die sie an der Wiener Staatsoper herausbrachte. Das Sujet von „Giselle“ sei, so Tschernischova, ein Glücksfall für das Theater, es behandle Themen wie „Liebe, Treue, Tod, Verrat“. Hier stehe das volle Leben vis à vis einer geheimnisvollen überirdischen Welt. Um den Kontrast dieser beiden Welten deutlicher herauszuarbeiten, verzichtet Tschernischova auf das tradierte Gegenüber von Farbigkeit und Weiß und betont stattdessen das „Clair-obscur“, das Helldunkel, das ihrer Meinung nach durch das Licht zusätzliche Tiefe und Schattierung gewinnt. „Durch den schwarz-weißen Hintergrund“, so die Ballettmeisterin, „wird alles, was auf der Bühne vor sich geht, nur noch verstärkt.“ Damit wolle sie dem Werk jene „etwas schärferen Konturen verleihen“, die für heute nötig seien.
Ganz anders Tschernischovas Landsmann Eifman. Er stellt seine Sicht unter die Symbolfarbe „Rot“ und siedelt den ersten Teil des Balletts in seinem Heimatland in den Zwanzigerjahren und somit in einer Zeit an, in der nicht parteikonforme Künstler mit den Obstakeln des „roten“ Regimes zu rechnen hatten. Mit der Überblendung der Rolle der Giselle mit Olga Spessiwzewa, die den Part unzählige Male verkörpert hatte, gelang Eifman tatsächlich ein Coup. Das Leben der Tänzerin verlief gemäß dem ihr bereits in der „roten“ Sowjetunion auferlegten Ballerinentyp der „femme fragile“ und der „weinenden Seele“. In den Westen gekommen, erlitt sie in den Dreißigerjahren mit dem Ausspruch, sie hätte diese Rolle wohl zu oft verkörpert, einen Nervenzusammenbruch, von dem sie sich nie mehr wirklich erholte.
 Anders hingegen Masilos „Giselle“, wobei das – nicht von der Choreografin stammende – Beiwort „noire“, gegen alle Sprachetiketten hinweg auch deswegen so benannt werden kann, weil die Sicht der Südafrikaner und -afrikanerinnen auf das alte Werk überaus selbstbewusst und vollkommen eigenständig ist. Mit der Fokussierung auf allgemeine überschäumende Tanzfreude greift Masilo das Hauptmotiv des Balletts auf, die Tanzlust. Wohl um den Rivalen die Möglichkeit zu geben, sich effektvoll um Giselle zu prügeln, rückt die Choreografin alte Regeln um Standesunterschiede in den Hintergrund. Völlig aus südafrikanischen Ritualen und Zeremonien gestaltet ist der zweite Akt mit seiner Heilerin Myrtha sowie den Willis als rot gekleideten bedrohlichen Ahnengeistern, die Giselle, die sich im Gegensatz zum Originallibretto als unerbittliche Rächerin erweist, mit sich ziehen.
Anders hingegen Masilos „Giselle“, wobei das – nicht von der Choreografin stammende – Beiwort „noire“, gegen alle Sprachetiketten hinweg auch deswegen so benannt werden kann, weil die Sicht der Südafrikaner und -afrikanerinnen auf das alte Werk überaus selbstbewusst und vollkommen eigenständig ist. Mit der Fokussierung auf allgemeine überschäumende Tanzfreude greift Masilo das Hauptmotiv des Balletts auf, die Tanzlust. Wohl um den Rivalen die Möglichkeit zu geben, sich effektvoll um Giselle zu prügeln, rückt die Choreografin alte Regeln um Standesunterschiede in den Hintergrund. Völlig aus südafrikanischen Ritualen und Zeremonien gestaltet ist der zweite Akt mit seiner Heilerin Myrtha sowie den Willis als rot gekleideten bedrohlichen Ahnengeistern, die Giselle, die sich im Gegensatz zum Originallibretto als unerbittliche Rächerin erweist, mit sich ziehen.
Im ursprünglichen Libretto ruft Myrtha die Willis aus aller Herren Länder zusammen. Unter ihnen sind zwar keine Vertreterinnen aus Afrika, wohl aber aus Indien beziehungsweise aus jenen Ländern, die man sich damals zu „Indien“ hinzudachte. Die Librettisten zogen damit die aus dem eurozentristischen Denken gesehenen fernen Länder heran sowie jene (sinnlichen) Geschöpfe, die man(n) mit diesen fernen Gebieten assoziierte. Dazu gehörte auch das heutige Bangladesch, aus dem der britische Choreograf Akram Khan stammt. Seine 2016 entstandene, von der Zeitschrift „tanz“ zur „Produktion des Jahres“ erklärte Fassung von „Giselle“ hat jedoch ganz andere Farben aufzuweisen. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist von trostloser Farblosigkeit dominiert. Als Angehörige einer Gruppe von Immigranten wird Giselle als Fabrikarbeiterin ausgebeutet, eine Verbindung mit einem Angehörigen einer anderen gesellschaftlichen Schicht kann nur letal enden. Damit aber greift Khan wieder zum stücktragenden Motiv des Originallibrettos zurück und zeigt damit einmal mehr die bleibende Aktualität des Alten.
 PS
PS
Welche Weltstadt – außer Wien! – kann sich mit dem Vorfahren eines Stadtrats für Kultur schmücken, der vor fast 200 Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Überlieferung der Willis-Sage geleistet hat? Der Schriftsteller Johann von Mailáth (1786–1855), ein Ahne von Andreas Mailath-Pokorny, hielt nämlich in seiner 1825 in Brünn herausgegebenen Anthologie „Magyarische Sagen und Märchen“ die Sage um die Willis fest. Das Hauptmotiv der Erzählung, die er „Der Willi-Tanz“ nennt, ist jenes, das vor ihm schon von Artner in Gedichtform gefasst worden war. Heine war, wie erwähnt, durch die Dichterin auf den Stoff aufmerksam geworden. Dass Heine wie schon Artner den Herkunftsbereich des Sagenkreises „slavisch“ nennt, Mailáth hingegen von einer „magyarischen“ Sage spricht, ist nicht weiter verwunderlich, gehörte doch die Willis-Heimat im Trentschiner Komitat (Slowakei) zur Zeit der Veröffentlichung der Schrift zum ungarischen Teil der Monarchie.
PPS
Eine andere Geschichte wäre es, der Frage nachzugehen, wann und aus welchen Gründen Grete Wiesenthal ihren „Willis-Schwung“ kreierte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu ihrer 1938 in Wien erstellten Choreografie zu Puccinis Oper. Jedenfalls war dieser Schwung für sie von so großer Bedeutung, dass sie seine Bezeichnung in die Terminologie ihrer Technik aufnahm.