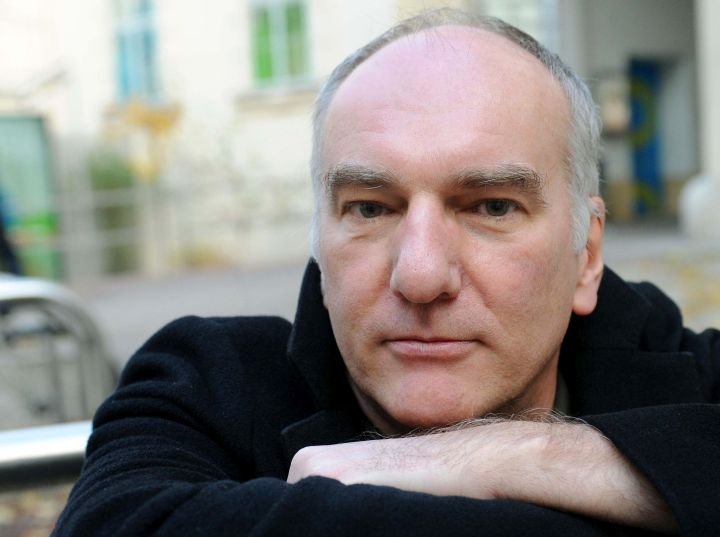 Walter Heun feiert seine finale Spielzeit mit einer Schau für die österreichische Performance-Szene. Stagnierende Kulturbudgets und steigende Kosten zwingen Institutionen wie auch Tanz- und Performanceschaffende, unter härter werdenden Bedingungen zu arbeiten. Der Intendant des Tanzquartiers Wien erzählt von der Lage der österreichischen und der europäischen freien Szene, vom Marketingbegriff „Koproduktionshaus“ und seiner Einschätzung des österreichischen Fördersystems.
Walter Heun feiert seine finale Spielzeit mit einer Schau für die österreichische Performance-Szene. Stagnierende Kulturbudgets und steigende Kosten zwingen Institutionen wie auch Tanz- und Performanceschaffende, unter härter werdenden Bedingungen zu arbeiten. Der Intendant des Tanzquartiers Wien erzählt von der Lage der österreichischen und der europäischen freien Szene, vom Marketingbegriff „Koproduktionshaus“ und seiner Einschätzung des österreichischen Fördersystems.
Als Finale Ihrer letzten Spielzeit widmen Sie der österreichischen Szene noch eine Schau….
Heun: Das Feedback ist ein Format, wo wir internationale Veranstalter einladen, die sich die hiesige Tanz- und Performance-Szene anschauen. Bei der letzten Ausgabe kamen 75 nationale und internationale Veranstalter nach Wien. Das ist der Abschluss der letzten Spielzeit, um die Künstler zu feiern. Das Festival ist sozusagen mein subjektiver Blick auf die Szene, da es die CPA – Choreographic Plattform Austria nicht mehr gibt. Und jetzt ist es eine gemeinsame Perspektive in Koproduktion mit dem Brut-Wien.
Rundherum in der Kulturszene wird immer wieder geklagt, dass das Kulturbudget weniger wird. Was sagen Sie, nach acht Jahren Intendanz des Tanzquartiers dazu?
Heun: Da würde der Kulturstadtrat widersprechen, weil das Kulturbudget gleich bleibt bzw. sogar in Teilen steigt. Aber von der Kaufkraft her betrachtet, wird es weniger.
Wie das Kulturbudget für die freie Szene aufgeteilt wird, ist nicht leicht verstehbar: Auf den Förderlist en stehen Koproduktionshäuser, die über das Budget der freien Szene subventioniert werden. Dann stehen da aber auch einzelne Künstler_innen, die in diesen Häusern auftreten und die zusätzlich über diese Förderschiene mit Projektförderungen subventioniert werden. Wie erklärt sich das?
en stehen Koproduktionshäuser, die über das Budget der freien Szene subventioniert werden. Dann stehen da aber auch einzelne Künstler_innen, die in diesen Häusern auftreten und die zusätzlich über diese Förderschiene mit Projektförderungen subventioniert werden. Wie erklärt sich das?
Heun: Also das mit dem Koproduktionshaus ist ein Marketingbegriff einer Wiener Institution, die vieles gemacht hat, aber weniges wirklich koproduziert hat. Es gab mal einen „common sense“ im Rahmen von IETM, einem internationalen Network für Performing Arts, was man so unter einer Koproduktion versteht, im Vergleich zur Ko-Finanzierung. Da hat man gesagt, Koproduktion bedeutet, dass man nicht nur Sachmittel, sondern auch finanzielle Mittel in eine Produktion steckt, und dass man die Künstler auch im Risiko begleitet. Da waren früher die Koproduktionsbeiträge wesentlich höher, als sie heute sind. Das ist eine Entwicklung in ganz Europa, die auch an der begrenzten Mittellage liegt, weil in vielen Ländern die öffentliche Förderung rückläufig ist. Deswegen konzentrieren sich immer mehr Veranstaltungshäuser aufs Präsentieren und die, die koproduzieren, verringern immer mehr die Beträge.
Wie ist es um die freie Szene in Europa bestellt?
Heun: Wir haben kürzlich einen Workshop mit dem EDN – European Dancehouse Network und der EACEA gemacht, die für das „Creative Europe“ Programm zuständig ist, und das Flanders Arts Institute stellte Zahlen aus Belgien vor. Man sagt ja, dass in Belgien die freie Szene noch besser gestellt ist, als anderswo. Da wurden Studien präsentiert, die besagen, dass Künstler_innen im Schnitt mit einem Bruttojahreseinkommen von 24.000 Euro auskommen müssen. Wenn man die 25 % Bestverdiener wegnimmt, liegt das bei etwa 17.000 Euro Brutto. Das wäre bei hiesigen Verhältnissen um die 1000 Euro netto, also knapp über der Armutsgrenze für die restlichen 75 %.
Was hat das für Auswirkungen?
Heun: Künstler_innen, die früher 1-2 Koproduzenten gebraucht haben, brauchen heute 6-7 Koproduzent_innen, um ihre Arbeit zu ermöglichen. Die Koproduktionshäuser reduzieren ihre Beiträge und verteilen sie auf mehr Künstler_innen. Für den Imagegewinn der Häuser ist das gut, das ist eine Marketingidee, man strahlt überall als Koproduzent, aber hat weniger getan. Erstaunlicherweise machen da einige Häuser mit, die mit der freien Szene zusammenarbeiten. Aber es ist im Prinzip ein neoliberales Agieren, man beschleunigt damit die Verarmung der Künstler_innen. Wir müssen auch mit reduzierten Mitteln – ohne dass wir eine Kürzung erhalten haben – umgehen. Wir koproduzieren nicht alles und jeden, versuchen nicht überall unser Label draufzusetzen, sondern konzentrieren uns auf einige wenige Künstler_innen, wo wir dann auch wirklich engagiert sind an der Karriereentwicklung.
Welche österreichischen Künstler_innen sind da dabei?
Heun: Über die Jahre hinweg wurde z.B. Ian Kaler mit aufgebaut, für die Produktionen mit dem Loose Collective haben wir uns engagiert, für Nadaproductions und Navaridas/Deutinger. Dann haben wir auch einige der Etablierten koproduziert wie Chris Haring oder Superamas, über die Jahre hinweg, mit denen haben wir über acht Jahre lang kooperiert, wobei wir diese Künstler_innen nicht aufgebaut haben, denn sie waren schon vorher sehr bekannt. Christine Gaigg haben wir auch über die Jahre koproduziert. Von den in Österreich ansässigen Künstler_innen, die hier am Haus gearbeitet haben, wurden eigentlich die meisten koproduziert.
Wenn Sie über die Jahre zurückblicken, wie hat sich die Situation verändert?
Heun: An unserem Haus kann man das gut sehen. Unser Budget wurde nur einmal erhöht, bei meiner Verlängerung, um 50.000 Euro. Das war das einzige Mal in der Geschichte des Tanzquartiers, dass es erhöht wurde und man merkt, dass die Kostensituation ansteigt: Personal, Raumkosten, technische Mieten, alles. Da kommt eine Menge zusammen und das wirkt sich immer mehr auf den künstlerischen Etat aus. Man kann sagen, dass das was vom Subventionsanteil in die künstlerische Produktion fließt, heute ungefähr 40 % weniger wert ist als 2001. Wir haben das teilweise durch Einsparungen auffangen können - z.B. im Marketing -, wir sind vermehrt Partnerschaften eingegangen und haben zusätzlich die Drittmittel erhöht, konnten für Einzelprojekte Ministerien gewinnen und den Bund auch immer wieder für Projekte, wie z.B. INTPA unser Fördersystem für Auslandsgastspiele.
Wie kann man sich die Gagen bzw. das Einkommen von Künstler_innen hierzulande vorstellen?
Heun: Das kann ich schlecht präzise beantworten. Aber ich würde mal sagen, dass man sich in Deutschland nach dem „art but fair“ Gedanken auf eine „normale Gage“ in der freien Szene bei ca. 2100 brutto einigen sollte. Bei Koproduktionen schreiben wir in der Regel den Kompanien nicht vor, wie sie ihre Künstler bezahlen. Wir schauen uns eher die Produktionsbudgets an und da sind die Niveaus sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man sagen, dass die Förderung für einzelne Projekte deutlich zurückgegangen ist, von der Höhe der Mittel, die zugesprochen werden, aber versucht man etwas mehr zu fördern.
Kann man sagen, es ist eine Rückkehr zum Gießkannensystem vor der Theaterreform?
Heun: Den Begriff würde ich ungern benutzen, weil der die Kurator_innen diskreditiert, die sich sicher Mühe geben. Aber die Frage, die sie sich stellen müssen ist, wie sie mit einem stagnierenden Budget umgehen sollen? Sollen sie nur wenige Künstler_Innen hoch fördern oder dafür lieber mehrere Künstler_innen? Es ist so ein bisschen dazwischen angesiedelt. Momentan finde ich, hat die 2- und 4-Jahres-Jury inhaltlich gute Entscheidungen getroffen, allerdings ist die Nicht-Beachtung der Superamas ein großer Fehler. Was ich strukturell noch fataler finde ist ein Trend – und anscheinend ist das nicht nur in Wien - dass man die Künstler_innen in einem Jahr fördert, im nächsten Jahr nicht. Das wird die ganze Szene langfristig austrocknen, weil die Künstler_innen im Jahr dazwischen in existentielle Krisen kommen. Die Künstler_innen hanteln sich finanziell durchs Leben, wenn sie eine Produktion machen und können garantiert keine Reserven aufbauen, um die Durststrecke zu überbrücken.
Man hört, dass sobald jemand einmal in einer anderen Kunstsparte ein Projekt macht, es vorkommen kann, dass diese Person sofort aus der Förderung fällt.
Heun: Das sind immer diese Begründungen: Dem einen wird gesagt, er agiert ja nur in Wien und nicht international, den anderen wird gesagt, sie sind zu international unterwegs, sie sind ja gar nicht mehr hier in Wien. Das ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Es gibt Kriterien und nach denen ist zu entscheiden. Jedes andere Argument hat da nichts verloren. Es geht bei Juryentscheiden immer um Stringenz und Transparenz.
Wie ist der Status von Kunstschaffenden im Performancebereich?
Heun: Ein Choreograf oder eine Choreografin heute, der mit andern Künstler_innen zusammenarbeitet, hat die gleichen Rechte und Pflichten eines mittelständischen Unternehmers, der grenzüberschreitend im europäischen Raum tätig ist. Er oder Sie hat nur im Gegensatz zur Unternehmerin nicht die Chance Gewinne einzufahren, sonst ist die Subvention rückzahlbar. Aber sie können keine Rücklagen bilden und kein Risikokapital bilden, wie der Unternehmer. Das Risiko ist groß, denn wenn die Produktion keinen Erfolg hat und man auf internationale Distribution gesetzt hat, sind Verluste nicht wieder auszugleichen. Setzt dann auch noch die Förderung für ein Jahr aus, verschwindet man völlig aus der internationalen Wahrnehmung und fängt wieder bei null an.
Wenn Sie jetzt auf die acht Jahre zurückblicken in denen Sie das Tanzquartier geleitet haben - wer sind die erfolgreichsten österreichischen Choreografen im Land und im Ausland?
Heun: Es gibt die Generation, die mit der Eröffnung des Tanzquartiers groß geworden ist: Leute wie Chris Haring, Philipp Gehmacher, dann kam Doris Uhlich dazu und dann sind wir bei der Generation von Ian Kaler, Loose Collective, Deutinger/Navaridas, Nadaproductions. Die Szene besteht aus internationalen Künstler-Innen, die hier leben und arbeiten, eine aus Chile, andere aus Frankreich, Brüssel, Dänemark usw. – eine wunderschöne Melange und eigentlich ein wunderbares „tool“ für das Stadtmarketing einer Stadt, die sich als weltoffen und kulturaffin definiert.
Wie haben Sie das Tanzquartier Wien unter Ihrer Leitung definiert?
Heun: Das Tanzquartier Wien ist nicht nur ein kuratierter Ort, sondern ein Haus wo künstlerische Forschung & Theorie einander begegnen. In den letzten acht Jahren ist es zunehmend auch ein Ort des gesellschaftspolitischen Diskurses geworden.
Gab es Künstler und Künstler_innen, wo schon Aufführungen am Haus geplant waren und deren Förderansuchen abgelehnt worden sind?
Heun: Natürlich gab es welche, wo man dachte, mein Gott, wieso kriegen die keine Förderung... Es gab auch Leute, die wegen Gesprächen zum Thema Förderung komplett das Handtuch geworfen haben. Ich sage immer, ein Fördermodell ist so gut wie seine Juror_innen, aber die wechseln ja. Man weiß aber auch nie, wie die Antragslage war. Wenn da 35 Anträge waren und man hat nur Geld für 15, dann ist es immer bitter. Ich war selbst in viele Juryentscheidungen eingebunden und weiß, wie hart es ist, in der letzten Runde, wenn man jemanden fördern möchte und nicht genug Geld da ist. Und dann kommt automatisch die Frage, fördern wir lieber mehr und mit weniger Geld oder setzen wir künstlerische Akzente? Die Schwierigkeit ist an der Stelle immer – eigentlich sollte eine Jury eine künstlerische Entscheidung treffen, aber es ist wird dann auch zu einer sozialen Entscheidung, ob man Künstler_innen fördert oder nicht.
Was passiert mit Künstler-innen, wenn Sie aus der Förderung fallen?
Heun: Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die deutlich unter die Armutsgrenze fielen, weil sie nicht mehr gefördert wurden. Das ist die Schwierigkeit, wenn Künstler_innen von einem Fördermodell abhängig sind, das eigentlich ausschließlich nach künstlerischen Kriterien erfolgen soll, aber gleichzeitig wird damit so etwas wie eine soziale Absicherung betrieben. Da vermischen sich die Argumentationen. Und an der Stelle sind so Fördermodelle immer brutal. Wie viele Künstler_innen wurden schon aufgebaut als sie jung waren und gefördert wurden. Im Mittelbau wurden sie dann noch mitgezogen, manche sind zum internationalen Durchbruch gekommen, andere haben das nicht geschafft. Das Ende der Karriere ist immer das Schlimmste. Es gibt immer wieder junge Künstler-innen, die euphorisiert sind und eine Zeitlang ohne Geld arbeiten und sich über die Perspektive freuen, vielleicht mal Geld zu bekommen, aber das Ende ist meistens brutal.
Wo sehen Sie Bedarf?
Heun: Ein Fördermodell sollte immer als ein zyklisches System bedacht sein. Was hier fehlt, aber in den meisten anderen Ländern auch – ist eine Idee dafür, was man mit den Künstlern und Künstlerinnen macht, die aus künstlerischen Gründen nicht mehr gefördert werden sollen. Da finde ich, sollte man im Fördersystem viel proaktiver agieren. Es sollte auch Möglichkeiten geben, Künstler_innen Umschulungen zu finanzieren, sodass sie zum Beispiel eine Weiterbildung machen können und in die Lehre gehen können oder in die Vermittlung. In Deutschland gibt es ein Transition-Center, das vom Bund gefördert wird und mit den Arbeitsämtern zusammenarbeitet. Wo man schauen kann, dass die Künstler_innen, die sich jahrelang verdient gemacht haben, dann nicht hinterher zum Sozialfall werden.
Wie stellen Sie sich so ein zyklisches Modell vor und was fehlt hierzulande?
Heun: Am Anfang einer Karriere wenn die Künstler und Künstlerinnen jung sind und viel Energie haben, machen sie eine Produktion nach der anderen. Aber irgendwann kommt der Moment, da fällt ihnen für ein Jahr nichts mehr ein oder die letzte Produktion war nicht erfolgreich und dann stürzen sie schnell ab. Deshalb muss ein Fördermodell immer zyklisch aufgebaut sein. Es sollte so etwas geben wie eine Debutförderung, dass Stücke erstmals entstehen können, dann muss es eine Produktionsförderung geben – sehr vieles davon ist in Wien schon Usus – dann braucht es die Möglichkeit einer mittelfristigen Kontinuität – das ist hier die Zweijahresförderung und dann gibt es noch die Vierjahresförderung. Was hier fehlt, aber in den meisten anderen Ländern auch: Was macht man mit den Künstlern, an denen die Zeit vorbeigegangen ist? Die künstlerisch unproduktiv wurden oder vielleicht keinerlei Publikum mehr haben, obwohl sie noch eine halbwegs künstlerisch interessante Arbeit leisten. Wenn sich das gar keiner mehr ansieht, macht das vielleicht auch keinen Sinn mehr. Ohne dass ich den Aspekt der Publikumsmenge als Bewertungskriterium einführen möchte. Wenn man bedenkt, die meisten weltbekannten Künstler und Künstlerinnen haben am Anfang ihrer Karriere das Publikum rausgespielt. Weil es nicht heißt, dass gute Kunst automatisch viel Publikum hat. Es muss durchaus im Rahmen eines Fördermodells möglich sein, Künstler_innen auch unabhängig von der Publikumsresonanz, die sich durch reine Zahlen ausdrückt, fördern zu können. Was Produzenten und Veranstaltungsorte dann mit den Künstler-innen machen, verläuft nach anderen Entscheidungsgrundlagen. Beides sind voneinander unabhängige Systeme, die nach unterschiedlichen Kriterien funktionieren.
Vielen Dank Walter Heun für das Gespräch!
Feedback 4 th Edition, Tanzquartier Wien und brut-Wien, 24. bis 27.4.2017, www.tqw.at , www.brut-wien.at
Walter Heun © Sabine Hauswirth, Walter Heun © Regine Hendrick